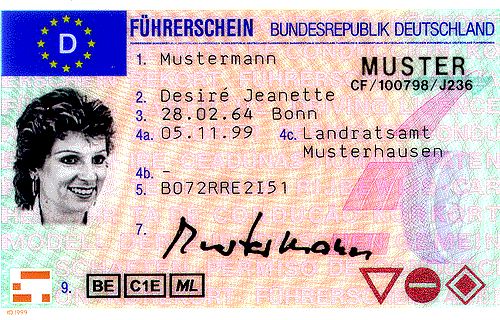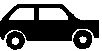|
Der neue
EU-Führerschein
Der
Ministerrat der Europäischen Gemeinschaften
hat bereits 1980 auf dem Weg zur Harmonisierung des Fahrerlaubnisrechts
mit
der Ersten Richtlinie über den Führerschein die
ersten Schritte
unternommen. Die Richtlinie enthielt im wesentlichen
-
die
gegenseitige Anerkennung der Führerscheine
im grenzüberschreitenden Verkehr und bei
vorübergehenden Aufenthalten
als Tourist oder Besucher,
-
den
prüfungsfreien Umtausch der Führerscheine
bei der Verlegung des Wohnsitzes der Inhaber in einen anderen
Mitgliedstaat,
-
Mindestanforderungen
an die theoretische und praktische
Fahrerlaubnisprüfung sowie die Tauglichkeit der
Fahrerlaubnisbewerber
und -inhaber und
-
die
Einführung des einheitlichen rosa EG-Modells
für den Führerschein.
Im
Jahre 1991 hat der
Ministerrat der Europäischen
Gemeinschaften die Zweite Richtlinie über den
Führerschein
verabschiedet. Kernstück ist die gegenseitige unbefristete
Anerkennung
der Führerscheine. Auch bei einer Verlegung seines Wohnsitzes
in einen
anderen Mitgliedstaat braucht der Inhaber den Führerschein
nicht mehr
in einen Führerschein des neuen Wohnsitzes umzutauschen. Ein
freiwilliger
Umtausch bleibt möglich. Wer einen neuen Führerschein
möchte,
kann diesen gegen Entgelt selbstverständlich bei der
örtlichen
Straßenverkehrsbehörde beantragen. Eine
Besitzstandswahrung ist
gewährleistet. Der aufnehmende Mitgliedstaat kann aber den
zuziehenden
Fahrerlaubnisinhaber registrieren und beispielsweise nationale
Gültigkeitsvorschriften anwenden.
Die
Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten weiter,
die internationalen Fahrerlaubnisklassen A, B, C, D, E
einzuführen.
Diese Klassen werden die bisherigen in Deutschland gültigen
Klassen
1 bis 5 ablösen.
Übersicht
über die Klassen
Klasse
A 
Krafträder
mit oder
ohne Beiwagen
Klasse
B 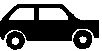
Kraftfahrzeuge
mit einer
zulässigen Gesamtmasse
von nicht mehr als 3 500 kg und mit nicht mehr als 8
Sitzplätzen außer
dem Führersitz (Auch mit Anhänger bis
0,75 t zulässiger Gesamtmasse
(zulässige Gesamtmasse des Zuges 4,25 t) oder mit
Anhänger über 0,75 t
zulässiger Gesamtmasse (zulässige Gesamtmasse des
Zuges 3,5 t). Letztere Kombination kann durch
Schlüsselzahl 96 auf 4,25 t zulässiger
Zuggesamtmasse erweitert werden.)
Klasse
C 
Kraftfahrzeuge
- ausgenommen
jene der Klasse D - mit
einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3500 kg (auch mit
Anhänger
bis 750 kg Gesamtmasse)
Klasse
D 
Kraftfahrzeuge
zur
Personenbeförderung mit mehr
als 8 Sitzplätzen außer dem Führersitz
(auch mit Anhänger
bis 750 kg Gesamtmasse)
Klasse
E 
Kraftfahrzeuge
der Klasse B,
C, oder D mit Anhänger
mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg (Ausnahme
Klasse
B, siehe selbe Seite unten).
Hervorzuheben
sind vor allem folgende
Änderungen:
-
In
der heutigen Klasse 3 für Pkw wird die Grenze
von 7,5 t auf 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht herabgesetzt.
Für
Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse 3 wird es aber - unter noch
festzulegenden
Bedingungen - Besitzstandsschutzregelungen geben.
-
Im
Bereich der Personenbeförderung in Kraftomnibussen
wird das bisherige Nebeneinander von allgemeiner Fahrerlaubnis der
Klasse
2 oder 3 und der besonderen Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeförderung zugunsten
einer einzigen Fahrerlaubnis der Klasse D aufgegeben.
-
Für
das Mitführen von Anhängern mit
einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg wird
künftig ein
besonderer Anhängerführerschein erforderlich sein.
Eine vor allem
für die Besitzer von Wohnwagen bedeutsame Ausnahme vom
Erfordernis des
Anhängerführerscheins gibt es bei Klasse B:
Ein Führerschein dieser Klasse genügt auch dann, wenn
der
Anhänger ein höheres zulässiges
Gesamtgewicht als 750 kg hat,
sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3 500 kg
nicht übersteigen.
Unterklassen
Im
Rahmen der neuen Klassen
können die Mitgliedstaaten
folgende Unterklassen bilden:
*
Klasse A 1 
Krafträder
mit einem
Hubraum von nicht mehr als
125 cm3 und einer Motorleistung von nicht mehr
als 11 kW
(Leichtkrafträder). Die Mitgliedstaaten können diese
Klasse durch
weitere Kriterien einschränken, wie z. B. eine durch die
Bauart bestimmte
Höchstgeschwindigkeit.
*
Klasse B 1 
Drei-
oder
vierrädrige Kraftfahrzeuge mit einer
Leermasse von nicht mehr als 550 kg. Die Mitgliedstaaten
können eine
niedrigere Leermasse festlegen und ebenfalls weitere
einschränkende
Normen hinzufügen.
*
Klasse
B 96 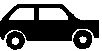 ab 19.01.2013
ab 19.01.2013
Kraftfahrzeuge
mit einer
zulässigen Gesamtmasse
von nicht mehr als 3 500 kg und mit nicht mehr als 8
Sitzplätzen außer
dem Führersitz (auch mit Anhänger bis zu einer
zulässigen
Gesamtmasse der Kombination von nicht mehr als 4250 kg)
*
Klasse C 1 
Kraftfahrzeuge
- ausgenommen
jene der Klasse D - mit
einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3500 kg, jedoch
nicht mehr
als 7500 kg (auch mit Anhänger bis 750 kg Gesamtmasse).
*
Klasse D 1 
Kraftfahrzeuge
zur
Personenbeförderung mit mehr
als 8 Sitzplätzen außer dem Führersitz,
jedoch nicht mehr
als 16 Sitzplätzen (auch mit Anhänger bis 750 kg
Gesamtmasse).
*
Klasse C 1+E, D 1+E 
Fahrzeugkombinationen,
die aus
einem Zugfahrzeug der
Klasse C 1 oder D 1 und einem Anhänger mit einer
zulässigen Gesamtmasse
von mehr als 750 kg bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse
der
Kombination 12 000 kg und die zulässige Gesamtmasse des
Anhängers
die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen. Bei der
Klasse D
1+E darf der Anhänger außerdem nicht zur
Personenbeförderung
verwendet werden.
Führerscheine
dieser Klassen werden auch in den
Mitgliedstaaten anerkannt, die diese Klassen in ihrer nationalen
Gesetzgebung
nicht einführen. Die Bundesrepublik Deutschland wird als
Ersatz für
die Klasse 1b die Klasse A 1, im Gegenzug zur Absenkung der Grenze
zwischen
der Pkw- und der Lkw-Klasse auf 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht
die Klassen
C 1 und C 1+E sowie die Klassen D 1 und D 1+E einführen. Im
Vorgriff
auf die Klasse A 1 ist die Klasse 1b bereits an die Richtlinie
angepaßt
und auf 125 cm3 und 11 kW erweitert worden.
Für 16- und
17jährige Leichtkraftradfahrer ist zusätzlich eine
bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgesetzt worden.
Daneben
gibt es Fahrzeuge, die nicht unter die Richtlinie
fallen, so daß die Mitgliedstaaten weiterhin ihre eigenen
Regelungen
treffen können. Dazu gehören z. B. die
Kleinkrafträder und
Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Hubraum bis 50 cm3
und
einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis zu 45 km/h
(künftig
Klasse M) und die land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
(künftig
Klassen L und T).
Stufenführerschein
Die
Richtlinie
enthält auch eine
Stufenführerscheinregelung für Krafträder
der Klasse A. Der
Erwerb dieser Klasse ist nach entsprechender Ausbildung und
Prüfung
ab dem 18. Lebensjahr möglich. Danach muß der
Motorradanfänger
zunächst mindestens zwei Jahre Fahrpraxis auf
Krafträdern mit einer
Motorleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis
Leistung/Gewicht
von nicht mehr als 0,16 kW/kg sammeln, bevor er in der Leistung
unbeschränkte Krafträder führen darf. Eine
weitere Prüfung
beim Aufstieg in die unbeschränkte Klasse ist nicht vorgesehen.
Die
deutschen Bestimmungen über den
Stufenführerschein sind im April 1993 bereits an die
EG-Regelungen
angepaßt worden. Künftig ist der "Direkteinstieg" in
die
unbeschränkte Klasse A möglich, wenn der Bewerber das
25. Lebensjahr
vollendet hat.
Inhaber der Klasse 1a, die das 25. Lebensjahr bereits vollendet haben,
jedoch
noch nicht zwei Jahre im Besitz dieser Klasse sind, haben die
Möglichkeit,
vorzeitig in die unbeschränkte Klasse A aufzusteigen, wenn sie
die
erforderliche praktische Ausbildung und Prüfung absolviert
haben.
Schutz
vor Mißbrauch
Die
Richtlinie verlangt
weiter, daß der Bewerber
in dem Staat, der die Fahrerlaubnis erteilt, einen ordentlichen
Wohnsitz
hat. Den ordentlichen Wohnsitz hat eine Person - vereinfacht gesagt -
dort,
wo sie wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder - bei
Fehlen
beruflicher Bindungen - wegen persönlicher Bindungen
gewöhnlich,
d.h. mindestens 185 Tage im Jahr wohnt. Mit dieser Regelung soll
verhindert
werden, daß jemand in mehreren Staaten eine Fahrerlaubnis
erwirbt und
im Falle der Entziehung einer Erlaubnis auf das andere Recht bzw. den
anderen
Führerschein zurückgreift. Ergänzend
bestimmt deshalb die
Richtlinie, daß jeder EG-Bürger nur eine
Fahrerlaubnis besitzen
darf. Zum anderen soll damit sichergestellt werden, daß jeder
die
Fahrerlaubnis dort erwirbt, wo er als Fahranfänger
überwiegend
am Straßenverkehr teilnimmt und wo er folglich mit den
Verhältnissen
besonders vertraut sein muß. Eine Sonderregelung trifft die
Richtlinie
für Studenten, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem
ihres ordentlichen
Wohnsitzes studieren. Sie können die Fahrerlaubnis entweder in
ihrem
Heimatstaat oder am Studienort erwerben, vorausgesetzt, daß
sie dort
mindestens für sechs Monate studieren.
Mindestanforderungen
Die
Richtlinie legt
gegenüber der Ersten Richtlinie
detailliertere Mindestanforderungen an die
Fahrerlaubnisprüfung fest.
Das deutsche Recht entspricht dem jedoch bereits weitestgehend oder
geht
darüber hinaus, so daß es in diesem Bereich keine
gravierenden
Änderungen geben wird. Dasselbe gilt für die
ebenfalls in der
Richtlinie geregelten Anforderungen an die körperliche und
geistige
Tauglichkeit der Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber. Eine Neuregelung
von
Gewicht stellen lediglich die in der Richtlinie vorgesehenen
ärztlichen
Wiederholungsuntersuchungen für Inhaber einer Fahrerlaubnis
der Klassen
C und C 1 dar, wobei die Mitgliedstaaten die Abstände
für die
Untersuchung selbst festlegen können. Solche Untersuchungen
kennt das
deutsche Recht bisher nur bei Busfahrern.
EG-Modell
des Führerscheins
Das
mit der Ersten Richtlinie
eingeführte EG-Modell
für den Führerschein wird leicht abgeändert,
um der Harmonisierung
der Fahrerlaubnisklassen Rechnung zu tragen und den
Führerschein sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft leichter
verständlich
zu machen. So wird insbesondere die Beschreibung der
Fahrerlaubnisklassen
durch Symbole ersetzt. Auflagen und Beschränkungen zur
Fahrerlaubnis
(z. B. das Tragen einer Brille) sollen künftig in codierter
Form in
den Führerschein eingetragen werden.
Außerdem
ist durch eine Ergänzung der Richtlinie
auch ein Führerschein in Form einer Scheckkarte zugelassen
worden. Die
Bundesrepublik Deutschland wird den Scheckkartenführerschein
einführen, da er ein hohes Maß an
Fälschungssicherheit bietet
und ein handliches, benutzerfreundliches Format besitzt.
Datenschutzrechtliche
Probleme wirft der Scheckkartenführerschein nicht auf, da er
nicht mit
einem Chip ausgestattet wird, sondern alle Angaben ohne technische
Hilfsmittel
lesbar sein werden. Auch der Scheckkartenführerschein wird
unbefristet
ausgestellt, wenn die zugrunde liegende Fahrerlaubnis - wie vor allem
bei
Krafträdern und Pkw- unbefristet erteilt wird.
Die
Umsetzung
Die
Richtlinie ist am 1. Juli
1996 in Kraft getreten.
Sie gilt in den Mitgliedstaaten aber nicht unmittelbar, sondern
muß
in das nationale Recht umgesetzt werden. Die Umtauschpflicht ist zum 1.
Juli
1996 aufgehoben worden.
Die neuen Regelungen treten zum 1. Januar 1999 in Kraft.
Nationale
Fahrerlaubnisklassen für Fahrzeuge,
die nicht unter die Richtlinie fallen:
Besitzstandsschutzregelungen
Die
Fahrerlaubnisse bzw.
Führerscheine, die vor
der Einführung der Neuregelung nach altem Recht erteilt
wurden, sind
auch nach Einführung des neuen Fahrerlaubnisrechts weiter
gültig.
Für
Inhaber, die ihre Fahrerlaubnis bzw. ihren
Führerschein vor der Einführung der Neuregelung
erworben haben,
bleibt grundsätzlich alles beim Alten. Die vor dem Stichtag
erworbenen
Besitzstände im Fahrerlaubnisrecht bleiben also erhalten. Bei
einem
freiwilligen Umtausch des Führerscheins werden in den neuen
Führerschein die neuen Klassen eingetragen, die den alten
Klassen
entsprechen.
1.
Der häufigste Anwendungsfall wird die bisherige
Klasse 3 sein.
Sie
reicht bis 7,5 t
zulässigem Gesamtgewicht.
Auf eine kurze Formel gebracht, lautet die Besitzstandsklausel:
Für
die alte Klasse 3 gibt es die neuen Klassen B und C 1. Die Klasse B
gilt
bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Die Klasse C 1
erfaßt den
Bereich von 3,5 t bis 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht.
2.
Ein anderer häufiger Fall ist das Mitführen
von Anhängern.
a)
Das bisherige deutsche
Führerscheinrecht kennt
keinen eigenständigen Anhängerführerschein.
Das Mitführen
von Anhängern ist bislang von der Fahrerlaubnis des ziehenden
Fahrzeugs
eingeschlossen.
Allerdings bestehen auch im bisherigen Recht schon bestimmte
Begrenzungen
und Differenzierungen für den Anhängerbetrieb:
-
Begrenzt
wird das Mitführen von Anhängern
zum einen durch entsprechende zulassungsrechtliche Vorschriften
(namentlich
über das zulässige Gesamtgewicht nach § 34
StVZO und über
die zulässige Anhängelast nach § 42 StVZO).
-
Zum
anderen spielt die Anzahl der Achsen eine Rolle
(bei der Abgrenzung der Klasse 3 zur Klasse 2).
-
Schließlich
kommt es auch darauf an, ob die
Anhänger zulassungsfrei sind (bei der Abgrenzung der Klasse 5
zur Klasse
2). Im einzelnen geht dies aus den Regelungen in § 5 StVZO
hervor.
-
Auch
die Regelung über das Mitführen von
Sattelanhängern für die Klasse 2 (vgl. § 5
StVZO) ist hier
zu berücksichtigen.
b)
Nach der Zweiten
EG-Führerscheinrichtlinie
ist grundsätzlich ein besonderer
Anhänger-Führerschein
erforderlich.
Allerdings
läßt die Richtlinie die
Anhänger-Führerscheinpflicht erst ab einer bestimmten
Grenze beginnen.
So ist für das Mitführen von Anhängern kein
besonderer
Anhänger-Führerschein erforderlich, wenn
-
das
zulässige Gesamtgewicht des Anhängers
nicht mehr als 750 kg beträgt oder
-
bei
der Klasse B das zulässige Gesamtgewicht der
Kombination aus Fahrzeug und Anhänger nicht mehr als 3.500 kg
beträgt.
-
bei
der Klasse B96 das zulässige Gesamtgewicht der
Kombination aus Fahrzeug und Anhänger mehr als 3.500kg aber
nicht mehr als 4.250 kg
beträgt
Erst
diejenigen, für
die die vorstehenden Regelungen
nicht ausreichen, benötigen einen
Anhängerführerschein, und
zwar
-
Klasse
B E: Dieser Führerschein berechtigt zum
Führen von Kombinationen (Zügen), und zwar unter
Beachtung des
§ 42 StVZO über die höchstzulässige
Anhängelast
(maximal 3.500 kg bei Pkw, maximal das 1,5fache zulässige
Gesamtgewicht
des ziehenden Fahrzeugs bei Lkw und bestimmten
Geländefahrzeugen).
-
Klasse
C 1 E: Das bei diesem Führerschein
zulässige Gesamtgewicht der Kombination (Zug) beträgt
maximal 12.000
kg, und das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers
darf nicht
höher als das Leergewicht des Zugfahrzeugs sein. Die
zulässige
Anhängelast muß dabei ebenfalls beachtet werden.
-
Klasse
C E: Das zulässige Gesamtgewicht der
Kombination (des Zuges) richtet sich nach § 34 StVZO, unter
Beachtung
der zulässigen Anhängelast nach § 42 StVZO.
c)
Für die
Besitzstandswahrung bedeutet dies:
-
Die
Inhaber der heutigen Fahrerlaubnis der Klasse 3
erhalten in jedem Fall die neuen Klassen B E und C 1 E.
-
Darüber
hinaus ist beabsichtigt, den Inhabern
der heutigen Klasse 3 auf Antrag die neue Klasse C E zuzuteilen, und
zwar
beschränkt auf die bisher in Klasse 3 fallenden Züge
(z. B. 17,5
t zulässiges Gesamtgewicht, bestehend aus 7,5 t für
Zugfahrzeug
und 10,0 t für einachsige Anhänger).
-
Praktisch
bedeutet dies, daß für die meisten
Gespanne aus Pkw und Wohnanhänger der Führerschein
der Klasse B
ausreichen dürfte. Für das Mitführen von
Boots- und
Sportpferdeanhängern wird man in einer Reihe von
Fällen am
Führerschein B 96 oder BE (Zugfahrzeug Pkw) oder am
Führerschein C 1 E
(Zugfahrzeug leichter Lkw) nicht vorbeikommen. Dies ist aber
für heutige
Inhaber der Klasse 3 kein Problem, denn sie haben ja am Stichtag der
Einführung des neuen Fahrerlaubnisrechts automatisch die
Klasse B E
und C 1 E.
3.
Die heutige Klasse 2
entspricht den künftigen
Klassen C und C E.
Wer
den Führerschein der Klasse 2 besitzt,
erhält die neue Klasse C E. Ohnehin wird seit 1. Oktober 1988
in der
Bundesrepublik Deutschland die Klasse 2 grundsätzlich nur noch
als
"Lastzugführerschein" erteilt. Nur in den Fällen, in
denen -
ausnahmsweise - die Klasse 2 ausdrücklich auf Solofahrzeuge
begrenzt
ist, wird nur noch die neue Klasse C gewährt.
4.
Die Erlaubnis, einen mit Fahrgästen besetzten
Omnibus zu führen, wird nach geltendem Recht durch eine
zusätzlich
zum Führerschein der Klassen 3 oder 2 erteilte "Fahrerlaubnis
zur
Fahrgastbeförderung" gegeben. Diese Erlaubnis ist bislang
keine
selbständige Fahrerlaubnisklasse, was darauf
zurückzuführen
sein mag, daß die technische Basis für
größere Omnibusse
lange Zeit mit der von Lastkraftwagen identisch war.
Mit
der Klasse D wird nun, dem internationalen Standard
folgend, eine eigenständige Fahrerlaubnisklasse für
Omnibusse (Kfz
zur Personenbeförderung mit mehr als 8
Fahrgastplätzen)
eingeführt. Für Omnibusse mit bis zu 16
Sitzplätzen ist die
Unterklasse D 1 vorgesehen.
Hier
gilt: Wer am Stichtag eine gültige Fahrerlaubnis
zur Fahrgastbeförderung nach § 15 d StVZO besitzt,
erhält
die neue Klasse D. Ist die alte Fahrerlaubnis auf eine bestimmte
Sitzzahl
beschränkt, so gilt diese Beschränkung auch
für die neue Klasse.
Eine Begrenzung auf 16 Sitzplätze ist identisch mit der neuen
Unterklasse
D 1.
Die
Geltungsdauer der künftigen Klasse D bzw.
D 1 soll voraussichtlich auf drei Jahre - was der
Gültigkeitsdauer der
heutigen Erlaubnis nach § 15 d StVZO entspräche -
oder auf fünf
Jahre festgelegt werden.
5.
Motorrad-Führerscheine: Nach dem geltenden
Recht gibt es vier Fahrerlaubnisklassen; künftig werden es nur
noch
drei sein.
-
Die
heutige Klasse 4 wird künftig Klasse M lauten.
Inhaltlich sind jedoch beide Klassen bis auf eine geringfügige
Abweichung
bei der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit identisch
(Krafträder
mit nicht mehr als 50 cm3 Hubraum und nicht mehr
als 50 km/h,
zukünftig 45 km/h bauartbedingter
Höchstgeschwindigkeit; Inhaber
einer Fahrerlaubnis der Klasse 4 dürfen weiter
Krafträder bis 50
km/h führen).
-
Die
heutige Klasse 1 b entspricht der künftigen
Unterklasse A 1. Die Unterklasse A 1 ist durch maximal 125 cm3
Hubraum und 11 kW Leistung begrenzt. 16- und
17jährige Inhaber
der Klasse 1 b bzw. A 1 dürfen jedoch nur solche
Motorräder
führen, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit
nicht mehr als
80 km/h beträgt.
-
Die
bisherigen Klassen 1a und 1 gehen in der neuen
Klasse A auf. Inhaltlich bleibt jedoch das Konzept des
Stufenführerscheins
erhalten. Die Klasse A (Mindestalter 18 Jahre) ist für die
ersten beiden
Jahre auf Krafträder mit 25 kW Leistung und einem
Verhältnis
Leistung/Gewicht von nicht mehr als 0,16 kW/kg (= mindestens 6,25 kg
Leergewicht/kW) begrenzt. Nach Ablauf der zwei Jahre dürfen
(ohne
Prüfung, lediglich Erfordernis der Fahrpraxis)
leistungsunbegrenzte
Krafträder geführt werden.
Mit
Wirkung vom 7. April 1993
wurden im Vorgriff auf
die Umsetzung der EG-Richtlinie bereits für die bisherige
Klasse 1a
die Leistungsgrenze 25 kW (anstelle von bislang 20 kW) und die
Begrenzung
des Verhältnisses von Leistung zu Gewicht von nicht mehr als
0,16 kW/kg
eingeführt.
Besitzstandsprobleme
können hier nicht
auftreten.
Besitzstandsregelungen
für Fahrerlaubnisse, die
vor Inkrafttreten der neuen Klasseneinteilung erteilt worden sind 1)
|
Klassen alt
|
Klassen neu
|
|
StVZO/D
|
StVZO/DDR
|
|
1
|
A
|
A, A 1, L, M
|
|
1 a
|
|
A beschränkt auf Krafträder
bis
25 kW und einem Verhältnis Leistung/Leergewicht von nicht mehr
als 0,16
kW/kg
A 1, L, M
|
|
1 b
|
|
A 1, L, M
|
|
2
|
C E
|
C, C E, C 1, C 1 E, B, B E,L, M, T
|
|
3
|
B, BE
|
C 1, C 1 E, B, B E, L, M;
auf Antrag C E mit Beschränkung
auf bisher in Klasse 3 fallende Züge
|
|
4
|
M
|
L, M
|
|
5
|
T
|
L
|
|
Fahrerlaubnis zur Fahrgast-
beförderung in KOM (unbeschränkt)
|
D
|
D, D E, D 1, D 1 E
|
|
Fahrerlaubnis zur Fahrgast-
beförderung beschränkt auf KOM
bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht und/oder 24 Plätze
|
|
D beschränkt auf KOM bis 7,5 t zul.
Gesamtgewicht und/oder 24 Plätze, D 1
|
1) ohne
Berücksichtigung von
früheren Besitzstands- und Einschlußregeln
|